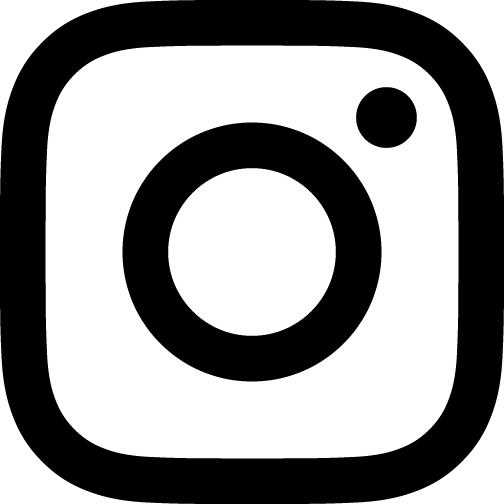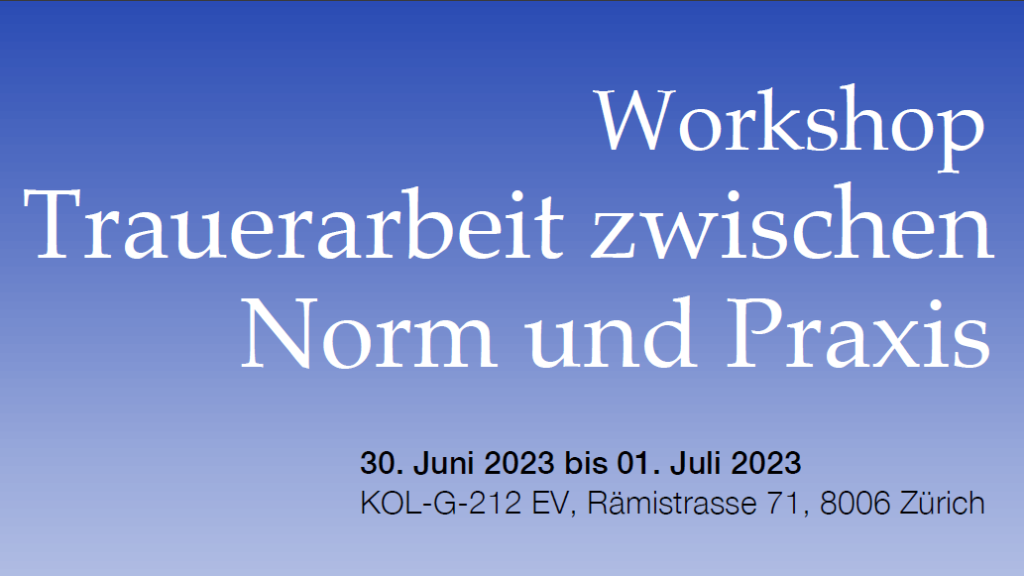
Welche Normen prägen geschichtlich und gegenwärtig unseren Umgang mit dem Tod? Was verraten demgegenüber Verhaltens- und Handlungsweisen im Kontext des Todes darüber, wie wir den Tod verstehen und wie wir die Toten auffassen, welche Existenzweise wir ihnen zuschreiben?
Um diesen und einigen anderen Fragen nachzugehen, fand am 30. Juni und 1. Juli der interdisziplinäre Workshop „Trauerarbeit zwischen Norm und Praxis“ an der Universität Zürich statt. Der Workshop wurde gemeinsam von Nicole Zellweger aus der Geschichtswissenschaft, Benedikt Brunner aus der Kirchengeschichte, Karina Frick aus der Linguistik und mir, Lea Gröbel, aus der Theologie organisiert. In insgesamt vier Workshop-Sessions versammelten sich an diesen beiden Tagen geschichtswissenschaftliche Beiträge aus der Frühen Neuzeit von Andreas Berger und Jan van Dijkhuizen, ethnographisches Datenmaterial, das für praktisch-theologische Arbeiten von Manuel Stetter erhoben wurde, und Auszüge aus einem linguistischen Twitterkorpus, die uns Susanne Kabatnik zur Verfügung stellte. Der Workshop bot einen breiten Austausch über einen Themenbereich, der etwas sperriger vielleicht auch mit „Umgangsweisen mit dem Tod und dem eigenen und fremden Sterbenmüssen oder -wollen“ hätte überschrieben werden können. Denn die Beiträge von Andreas Berger und Susanne Kabatnik rückten vor allem Phänomene im Kontext von Suizid(-gedanken) in den Fokus, die Antizipationen eines möglichen oder unmöglichen Lebens nach dem Tod implizierten. Dagegen behandelten die dichten Beschreibungen und Interviewdaten aus dem Umfeld der Bestattung von Manuel Stetter und die von Jan van Dijkhuizen präsentierten literarischen Stücke aus dem 16. und 17. Jahrhundert eher die Bearbeitung der postmortalen Existenz von bereits Verstorbenen. Obwohl das Quellenmaterial damit aus unterschiedlichen Zeiten und Zusammenhängen stammte, ergaben sich einige deutliche Verbindungslinien, die uns zu lebhaften Diskussionen und vertiefender Weiterarbeit anregten.
So komplementierten beispielsweise einige Tweets, die mit den Hashtags #Depression, #Suizid #Suizidgedanken oder #suizidal versehen wurden und aus einem 2020 von Susanne Kabatnik erhobenen Twitterkorpus stammten, den Aufsatz von Andreas Berger zu dem eher ungewöhnlichen Phänomen des ‚Suicide by proxy‘ im 18. Jahrhundert. Der ‚Suicide by proxy‘, der auf Deutsch am ehesten als ‚indirekter Suizid‘ oder als ‚Suizid durch ein Stellvertretungsvergehen‘ wiedergegeben werden kann, bezeichnet eine spätestens seit dem 16. Jahrhundert belegte Auswegshandlung oder Verzweiflungstat. Bei dieser versuchten meist gesellschaftlich, ökonomisch und gesundheitlich prekär gestellte Personen durch ein gegen sie verhängtes Hinrichtungsurteil aus dem Leben zu scheiden. Da das in den Zehn Geboten festgehaltene Tötungsverbot in der Frühen Neuzeit besonderer streng auch als Selbsttötungsverbot ausgelegt wurde, galt der Suizid als sündhaft und ging mit einer scharfen gesellschaftlichen wie religiösen Ächtung einher. Suizid war als schwere Sünde mit jenseitiger ewiger Verdammnis sowie diesseitiger obrigkeitlicher Strafe, Demütigung und Ausgrenzung für das soziale Umfeld der Suizident:innen belegt. Gleichwohl sahen einige Personen kaum einen anderen Ausweg aus ihrem Leben in Krankheit, Schmerz, Armut und Elend als durch den Tod. Der Tod durch die rechtmässige Hand des Henkers wurde in diesem Kontext als eine Möglichkeit gesehen, ein multipel geplagtes Leben durch den Tod zu beenden und dennoch auf die Gnade Gottes in einem heilvollen Jenseits vertrauen zu können. Aus diesem Grund begingen einzelne Personen Kapitalverbrechen wie etwa die Schändung von Sakramenten, als ‚Bestialität‘ kategorisierte Vergehen oder den Mord an ihren eigenen jungen Kindern. Besonders im Fall des Kindsmords vertrauten die Täter:innen darauf, dass ihre Kinder als sündenfreie Wesen direkt in den Himmel kommen und später wieder mit ihnen vereint werden würden. Da derartige Taten ein Hinrichtungsurteil nach sich zogen, konnten die so Verurteilten ihrem Leben indirekt ein Ende setzen, ohne eine postmortale Bestrafung ihrer selbst und ihrer noch lebenden Angehörigen fürchten zu müssen. Bezeichnend ist, dass das christlich-religiöse Normen- und Vorstellungssystem diese eher selten belegten Fälle des ‚Suicides by proxy‘ in doppelter Weise bedingte. Denn einerseits war es die christlich-religiöse Norm des (Selbst-)Tötungsverbots, die einen Suizid als Beendigung eines verzweifelten und schmerzbehafteten Lebens grundsätzlich unmöglich machte. Und andererseits ermöglichte die wiederum christlich-religiöse und gesellschaftlich quasi normativ verankerte Jenseitshoffnung auf befreiende Erlösung von Elend und Not überhaupt erst die Inkaufnahme der eigenen Hinrichtung. Gerade der Umstand, vor der Hinrichtung noch die seelsorgliche Betreuung durch einen Pfarrer in Anspruch nehmen, Buße leisten und sich mit der Familie versöhnen zu können, stärkte bei den Betroffenen das Vertrauen auf einen gnädigen Gott und die Erwartung der Wiedervereinigung mit den – im Falle einiger Kinder gar selbst getöteten – Angehörigen in der ewigen christlichen Gemeinschaft. So wurde in der Frühen Neuzeit in den Fällen des ‚Suicides by proxy‘ das eigene Sterben als Ausflucht aus einem von Schmerz und Verzweiflung gezeichneten Leben durch die feste Hoffnung auf ein besseres, erlöstes ewiges Leben getragen.

Bei den exemplarischen mit #Depression oder #Suizid getaggten Tweets aus dem Jahr 2020 kommt dagegen gerade das Fehlen jeglicher Jenseits- oder Zukunftshoffnung zum Ausdruck. In einem Tweet wird explizit gemacht, dass ‚dieses‘ Leben nicht mehr tragbar erscheint und es bei dem Gedanken an ein mögliches Ende dieses Lebens keine Zukunft mehr für die tweetende Person gebe. Ganz anders als in den indirekten Suizidfällen der Frühen Neuzeit, wird gerade die Hoffnungslosigkeit ausgedrückt, die die Krankheit der Depression kennzeichnet. Eine Erlösung durch den Tod oder die Aussicht auf ein besseres Jenseits kommt in den ausgewählten Tweets gerade nicht zur Sprache. Eine Parallele zwischen den in Tweets gefassten Suizidgedanken und den suizidal ausgerichteten Kapitaldelikten liesse sich allerdings in der Unausdrücklichkeit und der zugleich versuchten sozialen Sichtbarmachung des empfundenen Schmerzes ausmachen. In einem Tweet wird darauf verwiesen, dass Schmerz die derzeit dominierende Empfindung sei, diese jedoch nicht konkreter kommuniziert werden könne. Im unmittelbaren Anschluss daran wendet sich die tweetende Person wiederum direkt an die Twitter-Community, die über den Hashtag #Depression verbunden ist, und bedankt sich bei dieser. Auch beim ‚Suicide by proxy‘ gab es einen aus heutiger Perspektive wohl etwas makaber erscheinenden Gemeinschaftsaspekt. Der indirekte Suizid durch Hinrichtung konnte als ein Moment der Wiederaufnahme und Reintegration in die (religiöse) Gemeinschaft nach einer meist langen Periode der Desintegration und Marginalisierung aufgrund von stigmatisierten Krankheiten, Armut oder Depression verstanden werden. Grundsätzlich sind die existenziellen Lebensgrenzsituationen der suizidalen Personen in der Frühen Neuzeit und der zum Suizid tweetenden Personen der Gegenwart nur schwer vergleichbar. Trotzdem lässt sich zumindest feststellen, dass auch bei auf Twitter geteilten Suizidgedanken Momente erkennbar werden, die auf eine vorausgehende Desintegration und eine erneute gemeinschaftliche Reintegration durch die als stärkend und beistehend beschriebene Twitter-Community schliessen lassen. Diese Momente sind in den Tweets aber deutlich diesseitig verortet und bleiben ohne den Aspekt der Wiedervereinigung nach dem möglichen Tod.

Das, was im Umgang mit dem Tod bzw. mit Toten sichtbar und was unsichtbar ist, was sagbar und was unsagbar ist, wurde auch in der ethnographisch dichten Beschreibung der Abholung eines Verstorbenen im Rahmen der Bestattungspraxis greifbar, die uns Manuel Stetter zur Verfügung stellte. Eindrücklich beschrieben wurde dabei der penetrante, raumeinnehmende Geruch des Leichnams, welcher aber, obwohl er die Szene geradezu dominierte, während der Abholung konsequent unangesprochen blieb. Insgesamt war die Skizze der Abholung durch ein ständiges Pendeln zwischen andächtig pietätsbewusstem Schweigen und den zur Abholung nötigen Handlungen wie der Umbettung und dem Heraustragen des Leichnams charakterisiert. Gerade in diesem stetigen Wechsel wurde deutlich, wie der verstorbene Mensch im Zuge der Bestattungsaktivitäten (und -passivitäten) sowohl als tote wie auch als beziehungsmässig noch bedeutsame und in dieser Weise auch weiterhin präsente Person konstruiert wird. Das zeigte etwas anders auch ein Interviewausschnitt aus einem Gespräch mit einem Trauernden, dessen Frau etwa drei Jahre zuvor verstorben war. Einerseits sprach der Trauernde noch täglich mit seiner Frau, wobei ihm das Spüren eines Steines half, von dem ein weiterer im Grab der Frau und ein dritter an einer im Haus eingerichteten Erinnerungsstelle lag. Andererseits kommunizierte der Trauernde deutlich: Dass seine Frau verstorben ist, habe ihm die Leichtigkeit genommen. Trotz der Praktiken, die eine gewisse Anwesenheit der Verstorbenen für den Trauernden implizierten, war dieser sich gleichzeitig der Abwesenheit seiner verstorbenen Frau sehr bewusst.

Über die Umschreibung der empfundenen Anwesenheit von Verstorbenen ergab sich wiederum eine Brücke zu den von Jan van Dijkhuizen mitgebrachten literarisch-poetischen Texte aus dem 16. und 17. Jahrhundert. In diesen wurden insbesondere Geruchsmetaphern verwendet, um die fortbestehende Präsenz der Toten zu illustrieren. Anders als man aus spätmoderner Sicht vielleicht vermuten würde, sind es in den frühneuzeitlichen Gedichten nicht mit den Verstorbenen lebzeitlich verknüpfte Gerüche, die Erinnerungen an diese wachrufen. Es ist vielmehr ein Geruch selbst, der die Verstorbenen nach ihrem Tod metaphorisch repräsentiert. In gewisser Distanz zu den wahrscheinlich realistischen olfaktorischen (den Geruchssinn betreffenden) Ummantelungen der gelebten Personen wurden diese postmortal literarisch häufig mit floralen Düften umschrieben. Geruch kann dabei vornehmlich als Nahsinn aufgefasst werden, der im Prozess des Wahrnehmens zeitweise als mit dem rezeptiven Körper verbunden, ja als in diesen eindringend erlebt wird. Vor diesem Hintergrund drücken die Geruchsmetaphern für die Hinterbliebenen möglicherweise eine besondere Nähe und Verbundenheit zu den Verstorbenen aus. Darüber hinaus wäre es auch möglich, über diese Geruchsmetaphern Vergleichslinien zu frühneuzeitlichen Seelenvorstellungen zu ziehen: Wie ein Geruch könnte die Seele als unsichtbar und doch sinnfällig, als unspürbar, aber nicht immateriell aufgefasst worden sein.
Die Bedeutung der Sinneswahrnehmungen im Kontext des Todes und mögliche Seelenvorstellungen bilden nur zwei Bereiche, für die eine historisch vergleichende Weiterarbeit aussichtsreich erscheint. Trotz des sehr unterschiedlichen Materials und dessen verschiedenen Entstehungszusammenhängen in der Frühen Neuzeit und der (digitalisierten) Gegenwart zeigte sich in unserem Workshop deutlich, wie präsent die Verstorbenen im Leben der Hinterbliebenen sind. Auch dass Jenseitsvorstellungen oder gerade das Fehlen von diesen ein tragendes Element sind, um den eigenen Tod wie den von anderen fassen zu können, wurde an unterschiedlichen Stellen greifbar. Geschichtlich wie gegenwärtig wurden zudem Normen ersichtlich, die den Umgang mit Tod und Trauer prägten und fortwährend bestimmen. So besteht beispielsweise heute das weitverbreitete Ideal, dass die Verstorbenen aus dem Umfeld der Lebenden herausgelöst werden und der Trauerprozess ebenfalls nach einer gewissen Zeit zu einem endgültigen Abschluss kommt. Dagegen wird in zahlreichen kulturellen und religiös konnotierten Praktiken anschaulich, dass der Tod nicht einseitig als das Ende und der Abbruch des Lebens gelten kann. Stattdessen halten die Hinterbliebenen ihre Verstorbenen oft mit vielfältigen materiellen wie medialen Vergegenwärtigungsstrategien in ihrem Leben präsent.
Blogbeitrag von Lea Gröbel, UFSP-Projekt 2 Eschatologische Gehalte digitaler Gedenk- und Trauerpraktiken